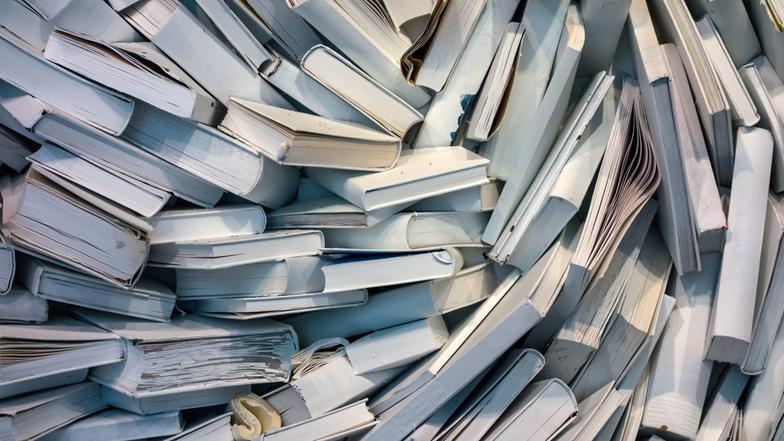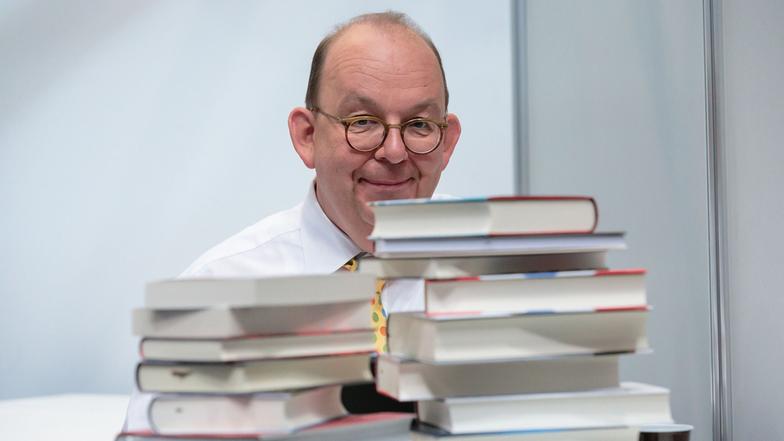Podcast
Orte und Worte: Literaturschaffende an ihren Lieblingsorten
Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung: Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ganz persönliche Themen, ihre aktuellen Bücher, das Schreiben und die kreative Arbeit. Und das immer an einem ungewöhnlichen Ort.
Mit Jaqueline Scheiber in der Wiener Burggasse
Architektin Klara hat Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen. Und dann geschieht es doch. KlackKlack, und schon hat sich Balázs in ihr Herz geschlichen, den sie immer wieder rüde zurückweist, wenn er zu nett wird. Der Ungar ist Bühnentechniker beim Theater, er wollte nicht in Orbáns Ungarn leben. Nach einer feucht-fröhlichen Party wacht Klara auf, Balázs liegt neben ihr – tot. In ihrem Debütroman beschreibt Jaqueline Scheiber, wie der Schock und die Trauer die Wohnung neu erscheinen lässt. Sie vermisst die Altbauwohnung mit "DreimeterDreißig" Deckenhöhe neu und rekonstruiert die Liebesbeziehung zu Balázs. Stephan Ozsváth spricht mit Jaqueline Scheiber auf einem Spaziergang über die Wiener Burggasse über Manisches Schreiben, die Arbeit mit Süchtigen, Offenheit im Internet und das Ungarn von Viktor Orbán.
Mit Sophie Sumburane auf dem Campus am Neuen Palais in Potsdam
Mit Krimis hat Sophie Sumburane es in den Bachmannwettbewerb in Klagenfurt geschafft, in diese altehrwürdige Show der Literaturkritik, wo 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander um die Wette lesen. Sophie glaubt sogar, dass sie die erste Krimi-Autorin überhaupt sein könnte, die teilnimmt. Es gebe eine Entwicklung, sagt Sophie, Kriminalromane würde heute nicht mehr nur als Genre-Literatur abgetan. Auf dem Campus am Neuen Palais in Sanssouci hat sich Nadine mit der Potsdamerin getroffen. Dort spielen Teile von Sophies letztem Roman "Tote Winkel", der um das Trauma einer Vergewaltigung kreist. Die beiden sprechen über feministische Krimi-Literatur und Sophies Engagement gegen Rassismus und rechte Gewalt.
Mit Nell Zink an den Schauplätzen von "Sister Europe"
Aus Virginia, USA, nach Brandenburg: Die Schriftstellerin Nell Zink lebt seit 25 Jahren in Deutschland, seit 2013 in Bad Belzig im Fläming. Dort hat Nadine sie schon mal getroffen für Orte und Worte. Nells neues Buch "Sister Europe" ist ein Berlin-Roman. Er spielt an einem einzigen Tag und einer einzigen Nacht. Ein bunt zusammengewürfelte Feiergesellschaft schleicht sich von einer Literaturpreis-Verleihung im leicht abgerockten Interconti-Hotel in den nächtlichen Tiergarten und diskutiert über alle möglichen Themen der Gegenwart. Geschlecht, Identität, Herkunft, Klimawandel, Kapital, Liebe. Nell und Nadine besuchen die Schauplätze des Romans und unterhalten sich über ein No-Future-Gefühl, die USA unter Trump, Bücher und Verdrängungstechniken.
Mit Katharina Köller am Wiener Donaukanal
Sie trägt knallgelbe Schuhe, als sie zum "Flex" am Donaukanal kommt, einem Nachtclub, den sie als Jugendliche auch viel besucht hat, und der ein Schauplatz in ihrem Roman "Wild wuchern" ist. Ihr Roman handelt von dem Ausbruch aus einer toxischen Beziehung und der Wiederannäherung der beiden Cousinen Marie und Johanna. Die naturliebende Johanna lebt als Einsiedlerin in einer Hütte in den Tiroler Bergen. Dort sucht Marie Zuflucht. Stephan Ozsváth sprach mit ihr über das Schreiben in "Slots", die das Kleinkind lässt, den Ärger über die Frage, warum toxische Männer sind wie sie sind, die Poesie von Wein-Beschreibungen, und warum sie als Autorin einen Instagram-Account braucht.
Natasha Brown und ein Gespräch mit Goldbarren
Bei ihrem Besuch in der rbb-Dachlounge brachte die englische Bestsellerautorin Natasha Brown einen Goldbarren mit, passend zu ihrem neuen Roman, in dem in einer Kernszene jemand mit einem Goldbarren fast erschlagen wird. "Von allgemeiner Gültigkeit" ist eine kritische Gesellschaftsanalyse über u.a. die Aufmerksamkeitsökonomie, aber auch über Klassismus und Herkunft. Die Schauspielerin Benita Sarah Bailey las Auszüge des Romans und Natasha Brown erzählte im Gespräch mit Anne-Dore von ihrer Entscheidung, ihren Job im Bankenwesen ruhen zu lassen, von ihrem Erfolg als Autorin und dem Wunsch, das Schreiben niemals zum Brotberuf zu machen. Und natürlich wurde auch die Frage nach der Echtheit des mitgebrachten Goldbarrens geklärt.
In der Seilbahn mit Annett Gröschner
In ihrem neuen Roman "Schwebende Lasten" erzählt Annett Gröschner die Lebensgeschichte einer Frau, die 1913 in Magdeburg geboren wird und zwei Weltkriege, Diktaturen und Demokratien übersteht. Die Liebe zu den Blumen bestimmt ihr Leben, sie arbeitet als Blumenbinderin, später dann als Kranführerin. Für den Blick von oben treffen sich Anne-Dore und Annett Gröschner zum Seilbahnfahren. Sie schweben über die Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf, steigen aus und begeben sich zwischen blühenden Frühlingsblumen auf die Spuren von Hannah. Und auch wenn diese auf den ersten Blick keine typische Heldin ist, so ist sie es auf den zweiten Blick eben doch: Weil sie uneitel ist, anpacken kann, immer weiterkämpft und mit ihrer Biografie stellvertretend steht für viele weibliche Lebenswege im 20. Jahrhundert.
Mit Clemens Böckmann unterwegs in Leipzig
Das Stasi-Museum "Runde Ecke", der Markt mit seinen früheren Untergrundmessehallen, eine versteckte Parkbank – all das sind Schauplätze im Debüt-Roman "Was du kriegen kannst". Clemens Böckmann erzählt darin von einem Autor, der durch Zufall eine Frau kennenlernt, die ihm seine Lebensgeschichte anvertraut. Eine Frau, die Opfer und Täterin zugleich ist. Uta hat in der DDR für die Stasi spioniert und als Prostituierte gearbeitet, erst freiwillig, dann unter Zwang. Der Roman beruht auf einer Begegnung im echten Leben und ist eine Collage aus Gesprächen, Ich-Erzählung, Stasi-Berichten, Protokollen und Aktennotizen. Ein Rechercheroman über die DDR, über Vertrauen, und den Versuch, eine Lebensgeschichte zu durchdringen. Wie erzählen wir uns Erinnerungen und wie gehen wir damit um, dass sie nie verlässlich sein können? Clemens und Nadine spazieren durch Leipzig, zu den Schauplätzen des Romans, und sprechen darüber.
Mit Susann Pásztor auf dem Friedhof
Ein Friedhof ist für Susann Pásztor ein ganz normales Ausflugsziel. Hier geht sie gerne spazieren. Sie mag die Ruhe und den Frieden zwischen alten Grabsteinen. Seit die Schriftstellerin ehrenamtlich Sterbende begleitet, hat sie einen gelasseneren Blick auf den Tod bekommen. Auch in ihren Romanen ist das zu spüren. Tragik und Komik, Skurriles und Alltägliches liegen immer direkt nebeneinander. In "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" etwa. Oder in ihrem neuen Roman "Von hier aus weiter". Ein Familien- und Freundschaftsroman, der Tod und Suizid behandelt, aber auch von Aufbruch, Loslassen und neuem Mut erzählt. Susann und Nadine haben sich auf einem der ältesten Friedhöfe Berlins getroffen: Dem St. Matthäus Kirchhof in Schöneberg. Sie haben die Gräber der Brüder Grimm gesucht, sich über den Sinn von Friedhöfen und den Tod unterhalten, und darüber, wie man heiter und leicht über ernste Themen schreibt.
Am Spreeufer mit Katharina Hartwell
Wie wuchs man als Mädchen in den 90er Jahren auf, mit welchen Schönheitsidealen, Rollen und Vorbildern? Und wie war es, in den Nuller Jahren erwachsen zu werden und in den Zehnern eine Familie zu gründen? Katharina Hartwell hat mit klugem soziologischem Blick und brillanter psychologischer Empathie über Wendepunkte und wichtige Bruchstellen einer weiblichen Biographie geschrieben. Der rote Faden des Romans ist eine Freundschaft: Mit 13 Jahren lernt Maren Inga kennen, und obwohl die beiden vieles trennt, begleiten sie sich durchs Leben. Anne-Dore und Katharina Hartwell treffen sich am Spreeufer in Moabit und sprechen über Gleichberechtigung und Körperbilder, die Frage, wie man seine Träume mit der Familiengründung vereinbart und über die "Großen Lieben" jenseits der romantischen, die ein Leben prägen.
Mit Feridun Zaimoglu auf einen Spaziergang durchs alte West-Berlin
Spazierengehen ist für Feridun Zaimoglu essenziell, um schreiben zu können. Er bekommt dabei nicht nur den Kopf frei und bringt Körper und Gedanken in Bewegung, sondern spürt dabei auch dem Rhythmus der Sprache nach. "Es ist oft vorgekommen, dass ich dann die Wortfolge und den Rhythmus der Schrittfolge und dem Schritttempo angepasst habe", sagt er. So sind auch die Sätze für seinen neuesten Roman "Sohn ohne Vater" entstanden. Ein Buch über Trauer und Verlust, Loslassen und Ankommen, ausgelöst durch den Tod des eigenen Vaters. Nadine hat sich mit Feridun für einen Spaziergang verabredet. Gemeinsam laufen sie durchs alte West-Berlin, an das der Autor, der in Kiel zu Hause ist, noch eigene Erinnerungen hat. Sie lassen sich treiben und sprechen über Prägungen, Trauer, Eigenarten, das Schreiben, Berlin vor und nach der Wende und natürlich über Bücher.
Mit Sara Gmuer in der "Platte"
Achtzehnter Stock – so heisst der neue Roman von Sara Gmuer. In der Hauptrolle geht es um Wanda und ihre Tochter. Sie lebt in einem Plattenbau in Berlin-Lichtenberg, immer den Fernsehturm am Horizont im Blick. Er ist Symbol für ein besseres Leben. Wanda ist Schauspielerin, hat nie Geld und versucht den Spagat zwischen Liebesbeziehung mit einem Leinwandstar, Care-Arbeit und Dreharbeiten am Set. Sie scheitert – und gewinnt am Ende doch. Die Hausgemeinschaft in der Platte fängt sie auf, sie beißt sich durch. Sara Gmuer kennt das Auf und Ab, diese Welten. Die Schweizerin war Rapperin, Model, Schauspielerin – ihr Debütroman "Karizma" dreht sich um eine Rapperin, die sich in der männerdominierten Szene durchsetzt. Heute lebt sie mit zwei Kindern und Mann in Berlin. Stephan Ozsváth hat sich mit ihr in Berlin-Lichtenberg in der "Platte" getroffen und sie zum Rappen animiert und mit ihr über Perfektionismus, Eitelkeit und Rap als Keimzelle von Literatur gesprochen.
Mit Antje Rávik Strubel über den Dächern Berlins
Der neue Roman von Antje Ravik Strubel führt mitten hinein in die Kultur- und Medienszene Berlins und Potsdams. Im Zentrum steht Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Tageszeitung. Einst löste sie mit einem Enthüllungsartikel einen Shitstorm aus, der einen gefeierten Berliner Theaterintendanten in Verruf und zu Fall brachte. Nun – nach seinem Suizid – gerät sie selbst ins Zentrum der medialen Erregungsspirale: Trägt sie etwa Schuld an seinem Tod?
Mit Nikoletta Kiss in der Oranienburger Straße
Márta und Teresa sind Kusinen, zusammen sind sie am Plattensee aufgewachsen. Dann zieht Teresa mit ihren Eltern nach Ost-Berlin. Márta folgt ihr in die Großstadt und taucht ein in die Literaturszene der DDR. Sie lieben den gleichen Mann, ein fatales Liebesdreieck entsteht - das sich in einem Städtedreieck entfaltet, Orte die auch Autorin Nikoletta Kiss etwas bedeuten: Budapest, wo sie geboren wurde. Ost-Berlin, wo sie aufwuchs und BWL studierte. Und Wien, wo sie heute mit ihrer Familie lebt und als Verlagslektorin arbeitet. In "Rückkehr nach Budapest" nimmt sie uns mit in die Vorwendezeit, die Ostberliner Bohèmeszene und die der Budapester Dissidenten, die in Privatwohnungen Samisdat-Schriften herstellten. Stephan Ozsváth hat Nikoletta Kiss in der Berliner Oranienburger Straße getroffen, wo die Schluss-Szene des Romans spielt.
Mit Franziska Hauser und Maren Wurster auf der Leipziger Buchmesse
Im Zug zu einer gemeinsamen Lesung fing es an, erzählen Franziska Hauser und Maren Wurster. Die beiden Schriftstellerinnen, die eine 1975 in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen, die andere 1976 im Schwabenland, reden über die eigene Prägung, darüber, wie sie aufgewachsen sind und dabei unbewusst heute dem gängigen Klischee der Ost- bzw. West-Frau entsprechen. Auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung prägt das Großwerden in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen Mutterschaft, die Liebe, Berufsweg? Und weil sie auf immer mehr Fragen und Themen stoßen, haben sie Autor*innen nach ihren Perspektiven gefragt und daraus eine Anthologie gemacht: "Ost*West*Frau" heißt sie. Darüber hat Nadine mit den Maren Wurster und Franziska Hauser auf der gemeinsamen Bühne von ARD, ZDF und 3Sat auf der Leipziger Buchmesse gesprochen.
Mit Zeruya Shalev im Berlin Verlag
Als sie dieses Mal Berlin besuchte, stellte die israelische Autorin Zeruyas Shalev keinen neuen Roman vor: Denn seit dem 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Krieg kann sie nicht mehr schreiben. Andere Dinge sind jetzt drängender: Demonstrieren gehen, Grabreden schreiben, kritische Artikel und Essays veröffentlichen. Anne-Dore hat die Bestsellerautorin im Berlin Verlag getroffen, in dem seit einem Vierteljahrhundert Shalevs Romane erscheinen. Sie sprechen über ihren momentanen Alltag, ihre Kritik an Netanjahus Politik, über den Roman, der in der Schublade wartet und Zeruya Shalev erzählt, warum sie schon als Fünfjährige Erzählungen von Frank Kafka kannte.
Alle älteren Folgen des Podcast "Orte und Worte" finden sich in der ARD Audiothek zum Nachhören.
Orte und Worte, die Schreibende damit verbinden
Unsere Hosts Nadine Kreuzahler, Anne-Dore Krohn und Stephan Ozsvath treffen unsere Gäste an Plätzen, die wichtig sind als Schauplatz oder Inspiration, mit dem Schwerpunkt in Berlin und Brandenburg. Die Challenge: Die Hosts stellen das aktuelle Buch in einer Minute vor. Das Extra: Host und Gast bringen ihre persönlichen aktuellen Lieblingsbücher mit.
Credits
rbb | 2023 | 14-täglich
Hosts: Nadine Kreuzahler, Anne-Dore Krohn, Stephan Ozsvath
Eine Produktion des rbb, Rundfunk Berlin-Brandenburg